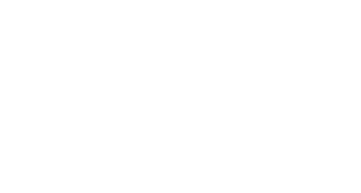Wunderbare Vielfalt und heitere Gelassenheit
Die Jahrestagung 2014 der Rudolf-Bultmann-Gesellschaft für Hermeneutische Theologie
"Verbindlichkeit und Pluralität - Die Schrift in der Praxis des Glaubens". Mit diesem Thema setzte sich die Rudolf-Bultmann-Gesellschaft für Hermeneutische Theologie e.V. auf ihrer 16. Jahrestagung vom 24. bis 26. Februar 2014 in Hofgeismar bei Kassel auseinander. In seiner Einführung zur Tagung verwies der Vorsitzende der Gesellschaft, der Tübinger Professor für Neues Testament Dr. Christof Landmesser, auf die Pluralität der biblischen Texte: "Sie sind in verschiedenen geschichtlichen Kontexten entstanden und tradiert worden. Sie wurden geschrieben von Menschen unterschiedlichster religionsgeschichtlicher Hintergründe. Sie wurden weiter gereicht, angereichert und vielleicht auch gekürzt in mehr oder weniger rekonstruierbaren Tradierungsabläufen. Die biblischen Texte lassen eine zuweilen kaum vereinbare Pluralität ihres Verstehens von Gott, Welt und Mensch erkennen." Umso schärfer stellt sich, so Landmesser, die Frage nach ihrer möglichen Verbindlichkeit. Landmesser dazu: "Für die neutestamentlichen Texte lässt sich tatsächlich der Christusglaube als das Gemeinsame benennen, mit dessen Hilfe das identifiziert werden kann, was im Anschluss an diese Texte als verbindlich betrachtet werden kann." Dieses müsse allerdings mit der je gegenwärtigen Situation und Wirklichkeit so verbunden werden, dass die beanspruchte Verbindlichkeit plausibel und nachvollziehbar erscheint. "Der Prozess der Interpretation erscheint so als niemals abgeschlossen", hielt der Neutestamentler fest.Sehr grundsätzlich griff die Professorin Dr. Melanie Köhlmoos den Problemkreis auf. In ihrem Vortrag "`Weil Gott die wunderbare Vielfalt liebt` - Die Pluralität biblischer Texte als theologische Aufgabe" - die Themenformulierung bezog sich auf ein Zitat aus einem Robin-Hood-Film - forderte die in Frankfurt/Main lehrende Alttestamentlerin "dringend" eine "theoretische Klärung des Text-Begriffs". Ausgehend von der literarischen und inhaltlichen Vielfältigkeit der Urgeschichte in Genesis 1-3 zeichnete die Referentin die Auslegungsgeschichte nach, die mit einer Paraphrase der Schöpfungsberichte in Sirach 16,24-17,7, einer Neuerzählung in Jubiläen II sowie einer Paraphrase in Josephus Antiquitates I,32-51 vorkritisch einsetzt, wobei "alle drei Texte ihre Vorlage so harmonisieren, dass ein narrativ und inhaltlich kohärenter Text entsteht". Erst die historische Kritik seit dem 19. Jahrhundert führte zu einer Pluralisierung der Texte. Die sprachlichen und sachlichen Unstimmigkeiten der biblischen Texte wurden jetzt als Hinweise darauf verstanden, "dass der biblische Text eine Zusammenfügung von Einzelschriften (´Quellen´) ist, die je für sich ihr eigenes historisches, sprachliches und theologisches Profil aufweisen". Theologisches Ziel, so Köhlmoos, ist dabei der Nachweis, "dass die Schrift eine vernunftgemäße Äußerungsform darstellt; also nicht grundsätzlich dunkel oder geheimnisvoll ist", und dass die Schriften in ihrer Endfassung zwar von Menschen verfasst und historisch später als die berichteten Ereignisse anzusetzen sind, aber auf alten, gegf. authentischen Quellen fußen.
Was Exegese leisten kann
Allerdings konstatierte Köhlmoos dabei einen "methodisch unklaren Zusammenhang zwischen der theologischen Provenienz des Auslegers und den Ergebnissen seiner Analyse". Die Exegese habe es versäumt, "sich über ihre texttheoretischen Grundlagen Rechenschaft abzulegen: Wenn die Quellen nicht Offenbarung sind, sondern historisch bedingte Äußerungen - nach welchen Maßstäben sind sie dann zu interpretieren?" Zu fragen sei, "ob Exegese ihrer Eigenart nach nicht eher unter die Textwissenschaften zu zählen ist. Eine wie immer geartete Verbindlichkeit - ich möchte lieber von Konsens sprechen - über den Sinn und die Bedeutung der (historisch entstandenen) biblischen Texte für gegenwärtige Praxis lässt sich eben historisch allein nicht gewinnen."Die Alttestamentlerin forderte "eine Texttheorie, eine Theorie der Interpretation und der Formulierung von Texten". Texte seien "keine beliebigen, sondern irgendwie stimmige Folgen von Sätzen; die Abfolge der Sätze entspricht einer diskursiven Logik, Texte besitzen eine Kohäsion". Ebenso haben sie "in einem gewissen Sinne und auf eine bestimmte Art und Weise Bezug zu unserem Wissen über die Welt, über die anderen und uns selbst; da besteht eine gewisse Kohärenz". Bei ihrer Lektüre und Interpretation wird "eine philologisch und philosophisch ambitionierte Theorie des Textes, die sich der genuinen Reflexion der eigenen Praxis der Vergegenwärtigung von Traditionen begrifflichen Wissens verdankt, (…) von besonderer Bedeutung sein", unterstrich Köhlmoos.
Mit seiner Ausgangsfrage "Was passiert eigentlich, wenn uns ein Text einleuchtet?" erweiterte der Professor für Systematische Theologie in Berlin, Dr. Notker Slenczka, die Frage nach dem Textbegriff. In seinem Vortrag "Historizität und normative Autorität der Schrift. Ein neuer Blick auf ein altes Problem" hob Slenczka hervor, dass ein Text "einleuchtet", gehe über das hinaus, was die Feststellung seines historischen Sinnes erreichen könne. Es bestehe eine Kluft zwischen Dogmatik mit ihrer Frage nach dem gegenwärtigen Wahrheitsanspruch der Texte einerseits und andererseits der historischer Exegese. Joseph Ratzinger bzw. Benedikt XVI. habe in seinem Jesusbuch das Problem durch eine "Kastration" der Exegese zu lösen versucht, derzufolge die über die Einsicht des historischen Autors hinausgehende Deutung der Kirche den eigentlichen Sinn, den der Text als Produkt der Kirche habe, zur Geltung bringt. Nach dem rezeptionsästhetischen Ansatz der neueren protestantischen Dogmatik dagegen "ist der Text dem Autor gegenüber autonom", er steuert einen Lese- bzw. Rezeptionsprozess, für seinen Sinn ist der Akt des Lesens konstitutiv: "Der Sinn eines Textes wird grundsätzlich plural." Und "die Frage nach dem Sinn eines Texte ist die Frage nach seiner Wirksamkeit in der Begegnung mit ihm." Die Gefahr bestehe allerdings, "dass der Text keine Möglichkeit mehr hat, sich gegen die Zumutungen der Rezeption zu wehren".
Sich selbst im Text erkennen
Eine Antwort auf das Problem findet Slenczka bei Augustin und Rudolf Bultmann. Schon Augustin habe darauf hingewiesen, "dass wir Aussagen über von uns nie gesehene Dinge darum verstehen, weil wir andere Exemplare derselben Gattung durch sinnliche Wahrnehmung kennen". Entsprechend dem damit gebildeten Allgemeinbegriff können wir uns ein Vorstellungsbild des zuvor nie Gesehenen gewinnen. Dem entsprechend können wir "die Rede von Gott darum verstehen, weil uns in uns selbst ein anderes unserer selbst erschlossen ist - der Gott, dem wir in unserem Inneren begegnen als dem, der uns innerlicher ist als wir selbst es sind". Mit seinem Begriff des Vorverständnisses habe Bultmann dieses von Augustin beschriebene Phänomen vor Augen gehabt. Slenczka: "Wir können Rede nur verstehen, wenn wir in das Gemeinte bereits eingeführt sind." Einen Text verstehen bedeutet damit, "selbst zu sehen, sich selbst bzw. die einem selbst erschlossene Welt bzw. das eigene Selbst in ihm wiederzuerkennen." Der Systematiker fragte, "ob nicht die biblischen Texte im Sehen einer Problematik der menschlichen Existenz und in der Eröffnung der Möglichkeit eines besonderen Umganges mit ihr ihre besondere Pointe haben, so dass man sie verstanden hat, wenn man durch sie auf sich selbst aufmerksam geworden ist".Dass der Psalter, insbesondere Psalm 22 als Grundlage der Kreuzigungsszene, die "Matrix" der alten Passionserzählung darstellt, ist in der Forschung längst bekannt. "Aber genauso wichtig wie die Psalmen von leidenden Gerechten sind die Königspsalmen, vor allem Psalm 2 als Eröffnungstext des Psalters, will man die spezifische Verwendung der titularen Trias Messias - Sohn Gottes - König (der Juden) in der alten Passionserzählung verstehen." Das war die These Professor Dr. Michael Theobalds in seinem Vortrag "´Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten?´ (Mk 14,61) - Zur Bedeutung des Psalters als Matrix der neutestamentlichen Passionserzählungen", in dem der Tübinger römisch-katholischen Neutestamentler ein Beispiel frühesten christlichen Schriftgebrauchs analysierte.
Theobald ging davon aus, dass schon die älteste Fassung der Passions- und Ostergeschichte eine deutende Erzählung sei, die Jesu Weg zum Kreuz im Licht der Psalmen, vor allem von Psalm 22, als Weg des leidenden Gerechten bzw. des leidenden Messias darstelle. Auf Grund einer eingehenden Analyse der historischen und textlichen Zusammenhänge in Bezug auf die Kreuzesaufschrift und die Szene vor dem Sanhedrin sowie des Psalms 2 kam Theobald zu dem Schluss: "Die älteste Passionserzählung knüpft an den als historisch anzusehenden titulus crucis an und erhebt ihn zu ihrem Angelpunkt." Der titulus zeige, Jesus sei "Opfer eines Erwartungsmusters geworden, demzufolge seine Rede von der ´Königsherrschaft´ Gottes unweigerlich theokratisch verstanden wurde". Die älteste Passionserzählung dagegen "entpolitisiere" den titulus, indem sie ihn einer christlichen Interpretation unterziehe. Der Neutestamentler: "Sie deutet ihn unter dem österlichen Vorzeichen im Licht des Psalters - insbesondere des ihn eröffnenden Psalm 2 - und faltet ihn rückläufig in die Trias König - Gesalbter - Sohn aus, eine Trias, die die Passionserzählung durchgehend prägt."
Nicht historisch ist, so Theobald, die Frage des Hohenpriesters: "Bist du der Messias/der Gesalbte, der Sohn des Hochgelobten?" Vielmehr verdankt sie sich, wie die gesamte Sanhedrin-Szene, "einem kreativen Erinnerungsakt, der das Skandalon des Kreuzes Jesu im Licht des Psalters ´aufarbeitet´. Die konkrete Gestalt der Szene dürfte aus der Schrift generiert sein, was auch auf andere Episoden der Passionserzählung zutrifft". Die frühchristliche Rezeption von Ps 2, Ps 110 und anderen Königspsalmen zeige, dass die christliche Lektüre des Psalters das früheste Echo auf Jesu eigene Verkündigung von der "Königsherrschaft" Gottes bilde. Zugleich bezeuge sie die Transformation von Jesu Verkündigung zum christos-basileus: "Dahinter steht die erste theologische Reflexion der Ostererfahrung."
Vergeblicher Schriftrekurs
An die Einsicht Gerhard von Rads, dass es sich bei biblischen Texten um "eingefrorene Streitgespräche" handelt, erinnerte der Kieler Neutestamentler Professor Dr. Enno Edzard Popkes in seinem Vortrag "Schrifthermeneutik und Erkenntnis - Schrifthermeneutik als Kristallisationspunkt frühchristlicher Trennungsprozesse". In den frühchristlichen Auseinandersetzungen, so Popkes These, habe der Rekurs auf die Schrift nicht geholfen, eher entzündeten sich an ihm die Kontroversen, so in den Diskursen um das Judenchristentum und um gnostische Schulbildungen.Während noch im Jakobusbrief und bei Matthäus eine Abgrenzung zur paulinischen Theologie nicht direkt formuliert erscheint, erfolgt sie expliziter in außerkanonischen Zeugnissen wie der judenchristlichen pseudoclementinischen Literatur. So in den Epistula Petri ad Jakobum und der Epistula Clementis, in denen Petrus und insbesondere der Herrenbruder Jakobus als Garanten der wahren Lehre Jesu dargestellt und "die paulinische Theologie und Schriftauslegungen als eine Verfälschung derselben diffamiert wird". Und in den Kerygmata Petrou nimmt der fiktive Petrus für sich in Anspruch, "durch seine Lebensgemeinschaft mit Jesus und durch die Einsetzung zum Fundament der Kirche zu einer tragenden Autorität geworden zu sein. Paulus wird hingegen dafür kritisiert, dass seine Deutung des Lebens und Wirkens Jesu nicht mit jener Botschaft zu vermitteln sei, die Jesus seinen Nachfolgern zu seinen Lebzeiten vermittelte". Im vierten Jahrhundert verlaufen sich die Spuren judenchristlicher Traditionsbildungen. Popkes: "Diese Facetten einer Pluralität im frühen Christentum blieben somit nicht erhalten. Und Rekurse auf autoritative bzw. heilige Schriften konnten nicht dabei helfen, diese Distanzierungen zu verhindern."
Mit gnostischen Strömungen hat sich als erster Irenäus von Lyon ausführlich auseinandergesetzt. In seinem Werk Adversus Haereses möchte er darlegen, "wo seines Erachtens die Grenzen einer Pluralität im Spektrum frühchristlicher Identitätsbildungsprozesse liegen". Der Vorwurf des allerdings zu Schematisierungen und polemischen Verzerrungen neigenden Bischofs an die von ihm angegriffenen Personen ist, "dass sie Worte Jesu, deren inhaltlich-sachliche Aussage eigentlich unmittelbar zu verstehen sei, leichtfertig umdeuten. Sie schreckten nicht einmal davor zurück, entsprechende Texte nach in ihren Interessen zu verändern". Irenäus versuche zu zeigen, warum die exegetischen Methoden seiner Gegner unberechtigt seien. Ganz anders dagegen Tertullian in seiner Schrift De praescriptione Haereticorum. "Für den Nordafrikaner", so Popkes, "ist nicht etwa ein sich abzeichnender Kanon bestimmter christlicher Schriften die Diskussionsgrundlage, sondern eine Regula fidei." Deshalb vertrete Tertullian die Auffassung, "dass mit Kontrahenten, die sich nicht zu der von ihm überlieferten bzw. formulierten Glaubensregel bekennen, überhaupt gar nicht erst diskutiert werden dürfe".
Bestätigt wurde die Kritik der frühchristlichen Autoren durch die Entdeckungen gnostischer Originalzeugnisse wie der Nag-Hamadi-Texte. Hier sei deutlich geworden, "dass eine Vielzahl gnostischer Schriften in der Tat auf der skizzierten Strategie basieren, vorgegebene Traditionen umzudeuten und weitere Texte als esoterische Sonderbelehrungen der frühesten Christen ins Feld zu führen". Dennoch hätten sich diese gnostischen Gemeinschaften "offensichtlich als Teil einer pluralen Gemeinschaft verstanden, innerhalb der plurales Nebeneinander unterschiedlicher religiöser Selbstverständnisse existieren konnte". Popkes resümierte, eine Kenntnis der Vielschichtigkeit des frühen Christentums könne eine "heitere theologische Gelassenheit" vermitteln, "eine Gelassenheit, welche die Stärke und Relativität der eigenen Position erkannt hat und die auch die Stärke und Relativität anderer Positionen bestehen lassen kann".
Lebensdienlichkeit als Kriterium
"Die Praktische Theologie sollte ausgehen von einer anthropologischen Grundbestimmung des Menschen als eines auf Freiheit unbedingt angewiesenen und zur Freiheit hin strebenden Wesens." Das forderte der Zürcher Professor für Praktische Theologie Dr. Thomas Schlag in seinem Vortrag "Anknüpfung und Widerspruch. Die Rede von der Schriftgemäßheit als Herausforderung gegenwärtiger Praktischer Theologie". Schlag kritisierte, dass die explizite Bezugnahme auf biblische Überlieferung in der gegenwärtigen kirchlichen Praxis aus dem Blickfeld gerate: "Eine Rezeption Bultmanns und der neueren theologisch-hermeneutischen Debatte stellt über das vergangene halbe Jahrhundert hinweg kein Kerngeschäft der Praktischen Theologie dar." Es deute sich aber an, dass seit einigen Jahren "eine hermeneutisch orientierte Theologie als Bezugswissenschaft der Praktischen Theologie für die Deutung gelebter Religion wieder stärker in das Blickfeld tritt". Der Praktische Theologe hielt fest: "Entscheidend und schriftgemäß erscheint es mir, dem Menschen in jedem einzelnen Fall ein freiheitlich selbstermächtigendes Deutungspotential des eigenen Lebens zuzutrauen, durch dessen Vollzug sich dann auch die Überzeugungskraft der Schrift erweist und ereignet."Schlag begründete seine These im Rückgriff auf Rudolf Bultmanns 1946 erschienen Aufsatz "Anknüpfung und Widerspruch", demzufolge der sündhafte Mensch in seiner Existenz und damit auch in seiner Sprache der Anknüpfungspunkt für das widersprechende Handeln Gottes ist. In diesem Widerspruch gewinne der Mensch die "Freiheit der Freiheit von sich selbst".
Vor diesem Hintergrund erweist sich für Schlag Schriftgemäßheit "am Kriterium der Lebensdienlichkeit aller Auslegung". Sie bemisst sich "zuallererst darin, dass jede je individuelle Auslegung zu ihrem Recht kommen kann". Zugleich hat sie jedoch diejenigen Gesichtspunkte und Bedürfnisse wahrzunehmen, "die vom Anderen her erschlossen und von uns entdeckt werden wollen". Daher "müssen sich alle verbalen und nonverbalen Kommunikationsformen der Kirche am Modell des Gesprächs orientieren". In der Religionspädagogik ist "die Verstehens-Arbeit mit biblischen Texten erheblich zu verstärken" und in der kirchlichen Öffentlichkeit der "produktive ethische Diskurs" unbedingt zu fördern. Pastoraltheologisch "dürfte es höchste Zeit für den theologisch profilierten Deuter bzw. die theologisch profilierte Deuterin des religiösen Leben in seiner ganzen Fülle sein".
Das Problem von Verbindlichkeit und Pluralität im konkreten Handeln der Kirche, im Gottesdienst, beleuchtete der Jurist und Theologe Oberkirchenrat Dr. Hendrik Munsonius, Göttingen. In seinem Vortrag "Das Jus liturgicum zwischen Verbindlichkeit und Pluralität" erklärte er: "Das Jus liturgicum hat die Funktion, das gottesdienstliche Handeln der Kirche zu ordnen. Es dient - wie alles Recht - der Handlungskoordination und der Konfliktregulierung." In ausführlichen theologischen, kirchengeschichtlichen, rechtssystematischen und rechtshistorischen Erörterungen wies der Oberkirchenrat auf, dass sich das Jus liturgicum als ein "sehr lebendiges und gestaltbares Recht" erweise, indem es sich darauf beschränke, einen äußeren Rahmen und eine Grundstruktur festzulegen, und die konkrete Gestaltung "dem Wechselspiel und der Verständigung unter den unterschiedlich Verantwortlichen" überlasse. Zum Gegenstad habe es die Vorgänge, "in denen die Vergegenwärtigung des Evangeliums durch Liturgie und Predigt geschieht, also zentrale Vorgänge, in denen die Normativität der Schrift entfaltet wird." Allerdings komme hier das Recht an seine Funktionsgrenze: "Zum einen ist der Gottesdienst zwar einer rechtlichen Ordnung zugänglich, weil seine äußere Form keine Heilsfunktion hat." Andererseits könne das Gottesdienstrecht den Reichtum des glaubensweckenden und glaubensstärkenden Kommunikationsgeschehens nicht determinieren.
Perikopenordnung verdeutlicht Binnenpluralität der Schrift
Das zeige sich vor allem in der Perikopenordnung, die Munsonius als ein "Kulturgut eigenen Ranges" bezeichnete. Da es in einem Gottesdienst unmöglich ist, die Schrift in ihrer Totalität wahrzunehmen, ist eine Auswahl notwendig. Munsonius: "In dieser Auswahl sollte jedoch stets ein Geschmack von der Schrift insgesamt wahrnehmbar werden, d.h. ihre Binnenpluralität muss erkennbar bleiben." Die allgemeingültige Festlegung der Lese- und Predigttexte stifte einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Gemeinden und könne so zum Ausdruck der "universalkirchlichen Dimension" werden. Auch nötige die Vorgabe eines Predigttextes zur Auseinandersetzung: "Als Prediger ist man weniger versucht, seinen eigenen Vorlieben und Beschränkungen zu folgen".So entfalte die Schrift ihre Normativität, wobei das Jus liturgicum für diese Auseinandersetzung und Vergegenwärtigung einen verbindlichen und verlässlichen Rahmen setze. "Die Kunst besteht darin, beides so miteinander zu verbinden, dass sich der Reichtum, der darin steckt, entfalten kann", schloss Munsonius.
Christoph Weist